______________________________________________________________________________________________________
L i n i e n , d i e z u Q u
e l l e n
f ü h r e n
k ö n n e n
Mai 2 0 2 2 -
vor 70 Jahren:
Im Mai 1952 veröffentlichte sie ihr erstes Buch:
"D i e W e i ß e
R o s e ".
Darin schilderte die Verfasserin
I n g e S c h o l l
(11. August 1917 - 4. September 1991) den Anti-Nazi-Widerstand der
hauptsächlich studentischen Gruppe um ihre Geschwister Hans Scholl (22.
September 1918 - 22. Februar 1943) und Sofie Scholl (9. Mai 1921 - 22.
Februar 1943).
In mehrere Sprachen übersetzt, ging dieser Band seither rund eine
Million mal über die Ladentische..
Am 7. Juni 1952 heiratete Inge Scholl den Ulmer Grafiker Otl Aicher (13.
Mai 1922 - 1. September 1991). Die Trauung in München St. Anna segnete
der Theologe Romano Guardini.
Seitdem trug Inge Scholl den Namen
I n g e A i c h e r - S c h o l l
Ermutigt von Otl Aicher hatte Inge Aicher-Scholl am 26. April 1946 die
vh ulm
Ulmer Volkshochschule mit gegründet. Inge Aicher-Scholl
leitete sie bis 1974 - ohne eigenes Abitur.
Die vh um arbeitet noch
heute, 2022. Motto damals: "Einmischen erwünscht".
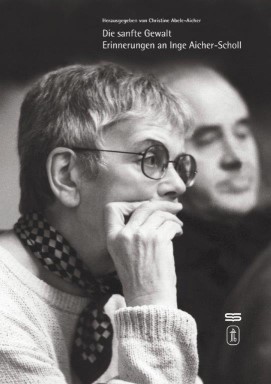
Am 1. August 1953
begann in den Räumen der "vh ulm" der Unterricht der damals neu
gegründeten "Hochschule für Gestaltung" (HfG) Ulm. Ins Leben gerufen
hatten sie vor allem Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher und der Schweizer
Architekt Max Bill. Ab 1955 lehrte die HfG in eigenen Gebäuden am
Oberen Kuhberg/Hochsträß Ulm. Sie bestand bis 1968. Otl Aicher diente
ihr ab 1962 zwei Jahre lang als Rektor.
1967 bis 1972 entwickelte Otl Aichers Büro das "Erscheinungsbild" für de
Olympischen Sommerspiele Kiel und München 1972. Er gilt als
"Piktogramm-Papst" ("Süddeutsche Zeitung"). 1988 veröffentlichte er die
Schriftenfamilie "Rotis".
Auf Otl Aichers 100sten Geburtstag am 13. Mai 2022 weisen mehrere
Ausstellungen und viele weitere Veranstaltungen hin. Das "Internationale
DesignZentrum" (IDZ) Berlin veröffentlicht am 13. Mai 2022 die
(Internet--)Seite OA100.
Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher erwarben um 1970 die Rotismühle am
östlichen Rand der "Großen Kreisstad Leutkirch" im Kreis Ravensburg -
Grenze Baden-Württemberg/Bayern (zwischen München und Lindau; rund 37
Autominuten von Lindau entfernt.) 1972 zog ein großer Teil der Familie
von Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher nach Rotis. Dort arbeitete bis
1991 auch das "büro aicher" - später "rotis büros".
Inge Aicher-Scholl äußerte sich mehrmals öffentlich politisch.
1963 protestierte sie mit zwei jungen Richtern gegen die geplanten
"Notstandsgesetze" in Ulm. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre prägte
sie als Organisatorin und aktiv Beteiligte die "Ostermärsche" gegen
Krieg in Ulm. Seit 1969/1970 machte sie sich für die KZ-Gedenkstätte
Oberer Kuhberg Ulm stark. Ab etwa Mitte der 1970er Jahre gehörte sie zur
"Arbeitsgruppe Friedenswoche Leutkirch". In den 1980er Jahren setzten
sich Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher vor das US-Atomwaffen-Depot
Mutlangen. Dafür verurteilte das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd Inge
Aicher-Scholl zu 800 D-Mark Strafe - wegen "Nötigung". In den 1990er
Jahren hob das Bundesverfassungsgericht diese Urteil auf. Begründung:
Sitzen sei keine Nötigung. 1986 protestierten Inge Aicher-Scholl und Otl
Aicher gegen Atomkraft.
Aus der Ehe gingen 1953 bis 1960 fünf Kinder hervor.
Julian Aicher (* 1958) ist der zweite der drei Söhne.
Genaueres über Inge Aicher-Scholl schildern rund 50 Berichte von Leuten,
die ihr begeneten, in Christine Abele-Aichers (2012 erschienenen) Buch
"Die sanfte Gewalt - Erinnerungen an Inge Aicher-Scholl"
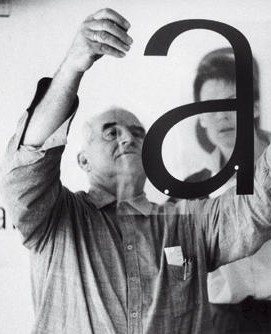
"Wie ist das als Sohn von so bekannten Eltern ?"
Diese Frage hörte Julian Aicher immer wieder.
Und: Wie prägten seine Herkunftsfamilien Julian Aicher politisch?
Dazu hier in dieser Rubrik L a n g e L i n i e n einige Texte, die Julian Aicher seit 2021 geschrieben hat. In lockerer Folge. Ob noch mehr davon dazu kommen? Das ergeben weitere Blicke hier in die L a n g e n L i n i e n .
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, fehlt die Geduld, so lange zu warten?
Dann klicken Sie doch einfach gleich in
www.ingeaicherscholl.de
Dort können Sie bei Christine Abele-Aicher ihr Buch "Die sanfte Gewalt.
Erinnerungen an Inge Aicher-Scholl" bestellen.
So
lange Vorrat (noch) reicht.
In diesem Buch: Ein Kapitel von Julian
Aicher mit Titel:
"Die langen Linien".
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, wollen
m e h r über Julian
Aicher wissen?
Dann klicken Sie doch einfach auf das Bild oder
hier!

Text 1 vom 22.04.2021
"Was anderes" ?
"Wie ist das eigentlich? Wie lebt sich’s mit so bekannten Eltern?"
Fragen, die ich
seit Jahren immer wieder höre.
Eher: seit
Jahrzehnten.
Dieser Text
liefert einige erste Antworten darauf.
Antworten etwa auf solche Fragen:
Wie präg(t)en mich Einflüsse, Vorbilder und Erzählungen
meiner Mutter und meines Vaters? Wie Äußerungen anderer älterer Verwandter?
Welche Linien zieht das in und durch mein
Leben?
Doch zunächst mal:
„So bekannt“ oder gar „so berühmt“ – wer ist damit
gemeint?
Wenn ich in meiner oberschwäbischen Heimat Autobahn
fahre, dann erinnern mich Hinweisschilder (auf die Städte Isny und Memmingen)
nahe der A 7 und der A 96 an das „büro aicher“. Also an jene graphische
(Entwurfs)-Werkstatt meines Vaters Otl Aicher (13. Mai 1922 – 1. September
1991). Die „Süddeutsche Zeitung“ beschrieb ihn als „Piktogramm-Papst“. Also als
prägender Ideen-Geber und (Mit-)Entwickler von rund 700 Zeichen – vom
Hinweis-Täfelchen - sowohl zur Toilette bis hin zur Landmaschine – bis zum
Symbol für bestimmte Alltagsgegenstände
(wie Telefone) und Sportarten. Möglichst international verständlich. Und von
anderen weiter entwickelbar. Zum Beispiel teils weiter entwickelt als
„Ficktogramme“ im „Plaboy“. Über sie schmunzelte Otl Aicher mal milde.
Mein Vater also als Bild-Sprachen-Genie. Otl Aicher –
über Grafiker-Kreise `raus international bekannt als „Gestaltungsbeauftragter“
der Olympischen Sommerspiele München und Kiel 1972. Und als Mitgründer und
zeitweiliger Rektor der „Hochschule für Gestaltung“ (HfG) Ulm (1953 – 1968).
„So bekannt“ oder „so berühmt“. Das gilt nicht minder
für meine Mutter Inge Aicher-Scholl (11. August 1917 – 4. September 1998).
Im Mai 1952 veröffentlichte sie das Buch
„Die Weiße Rose“. Es beschreibt vor allem das Leben und Sterben ihrer
Geschwister Hans Scholl und Sofie Scholl. (Sofie
schrieb sich selbst mehrmals mit f.) Das Buch schildert also Mitglieder einer
Gruppe hauptsächlich von Studentinnen und Studenten. Einen Freundeskreis. Sie
hatten besonders von München und Hamburg aus ab 1942 zum Widerstand gegen die
Nazi-Diktatur aufgerufen. Heimlich – da damals streng verboten. Meist mit
Flugblättern. Die meisten davon wohl per Post verschickt.
Inge Aicher-Scholl (bis Mai 1952 noch Inge Scholl)
schrieb dieses Buch als älteste Schwester von Hans und Sofie Scholl. Beide am
22. Februar 1943 im Gefängnis München-Stadelheim enthauptet. Kurz bevor das
Fallbeil auf seinen Nacken zuraste, soll mein Onkel Hans Scholl noch gerufen
haben: „Es lebe die Freiheit!“
Mit Hans und Sofie Scholl starb am gleichen Tag ihr
Studienfreund Christoph Probst. Selbst junger Familienvater. Später die
Kommilitonen Alexander Schmorell und Willi Graf sowie Professor Kurt Huber.
In Hamburg Hans Leipelt. Sie wirken
heute, 2021, als Namensgeber für viele Schulen, Straßen und Plätze. Sofie
Scholls Büste schaffte es 2003 gar ins bayerische „Walhalla“.
Meiner Mutter Inge Aicher-Scholls Buch „Die Weiße Rose“
fand sein Lesepublikum in etlichen
Sprachen – wohl weit über eine halbe Million mal gedruckt.
Wie erlebe und spüre ich als Sohn solch berühmter Eltern
diese Verwandtschaft? Wie prägt(e) mich das? Was empfinde ich als Neffe von
Häuptern der deutschen Widerstandsbewegungen gegen die Nazi-Verbrecher von
solchen familiären Verbindungen? Welches Licht strahlt daraus ab? Welche
Schatten wirft’s? Und falls ja – wie aus ihnen `raustreten?
„Was besseres?“
„Wenn man das weitermachen soll, dann müsst Ihr das
jetzt übernehmen.“ Diesen Rat, diesen Wunsch hörte ich wohl ums Jahr 2000 von
meiner Tante Elisabeth „Lisl“ Hartnagel-Scholl (27. Februar 1920 – 28. Februar
2020).
Sie hatte nach dem Tod meiner Mutter Inge Aicher-Scholl
1998 die Aufgabe übernommen, vor allem an Schulen über die „Weiße Rose“ und
andere Widerstandsgruppen gegen die Nazi-Diktatur zu berichten. Als letzte
lebende Schwester von Hans und Sophie Scholl. Elisabeth starb am 28. Februar
2020 – einen Tag nach ihrem 100sten Geburtstag. Wenn also am 9. Mai 2021 nicht
wenige an den 100sten Geburstag von Sofie Scholl denken, dann wohl die
wenigstens mit dem Wissen, dass in dieser Familie tatsächlich eine das 100ste
Lebensjahr erreicht hatte.
Informieren über „Freiheits“-Linien deutscher
Geschichte. Bereits während der Bauernerhebungen 1523/1525 soll auf einer Fahne
das Wort „Freyheit“ gestanden sein – so ein Druck aus damaliger Zeit. „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit“ als wichtige Revolutions-Forderung in Paris 1789.
Die „Freiheits-Statue“ in New York. „Freiheit“ – 1943 gefordert von einem
Verwandten von mir.
Persönlich lernte ich (* 20. März 1958) Hans und Sofie
Scholl nie kennen. Aber aus rund 1.000 bis 1.500 Seiten „Fach“-literatur. Und
noch mehr aus Berichten von Leuten, die die Widerstandsmutigen noch hautnah
erlebten: Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher, Elisabeth Hartnagel-Scholl, Fritz
Hartnagel, Robert Scholl, Hedwig Maeser, Anna Aicher …
In dieser Rolle als „Zweitzeuge“ werde ich seit über 40
Jahren immer wieder gefragt. Ende der 1990er Jahre stand ich vor einer
Hauptschulklasse. Ihr sollte ich über die „Weiße Rose“ erzählen. Kurz vor Ende
der Stunde meldete sich ein Schüler. „Sind Sie `was besseres?“, fragte er.
Meine Antwort: „Nein. Nicht was besseres. Aber
vielleicht was anderes.“
Denn: Wer wird schon vor dem herzhaften
Hand-Nach-Klopfen einer frisch geklebten Briefmarke zögern, weil die dort
gezeigten eigene Verwandte sind? Oder: Wer hört auf der Straße „Glückwunsch zur
`tagesschau‘“, nachdem ich in dieser Sendung am 22. Februar 2018 zur Gedenkfeier
im Gefängnis München-Stadelheim gesagt hatte: „Das berührt mich“ ? Oder die
Bestätigung „Ich fand’s toll, dass Du da so offen warst“, nachdem ein längeres
Gespräch mit mir am 17. Oktober 2017 bei „Ken FM“ erschienen war.
Als Radio „Bayern 2“ im Januar 2014 berichtete, das
Fallbeil, unter dem mein Onkel Hans und meine Tante Sofie 1943 starben, sei
jetzt wieder entdeckt worden (und nicht in der Donau versenkt, wie es lange Zeit
hieß), da meinte ich zu meiner Frau Christine Abele-Aicher: „Ich muss mich jetzt
erstmal hinsetzen.“
Zufall, dass ich mit einer schönen Frau verheiratet bin,
deren Großvater als Nazi-Gegner im Gefängnis Schwäbisch Gmünd gesessen war? Vor
Hitlers Diktatur hatte Bäckermeister Johannes Abele (4. Februar 1896 - ) im
schwäbischen Waldstetten schon früh gewarnt. Und dann doch diese Schreckenszeit
überlebt. Sein ältester Sohn, mein Schwiegervater, erzählt noch heute
gelegentlich davon. Die schmackhaften „Briegl“ der Bäckerei von Bruno und
Hannelore Abele in Waldstetten bestätigen den Durchhaltewillen lecker.
„Der kennt Dich“
Eines Abends kam Christine von ihrer Arbeitsstelle heim
und sagte: „Heute hat mal wieder einer respektvoll gestaunt. Und zwar, nachdem
ich mit „Ja“ geantwortet habe, als er fragte, ob ich mit Aichers verwandt bin.“
„Oh nein – nicht schon wieder Otl Aicher!“, dachte ich. „Nein, nein“ beruhigte
mich meine Frau: „Der kennt D i c h .
Von den Rockkonzerten, die Ihr früher
hier in der `rotisserie‘ veranstaltet habt.“ Also meist bestens besuchte
Veranstaltungen mit guten Tönen unter einem beschaulichen Gewölbe – wohl um 1900
von italienischer Meisterhand gefertigt und 1970/71 nach Plänen meines Vaters
Otl Aicher zur Kantine für sein „büro aicher“ umgestaltet. Ein Raum fast wie
eine kleine Kirche. Ursprünglich hier in der Rotismühle bei Leutkirch genutzt
als Viehstall („20 GV“). Wohl in einer Zeit, da Kühe auch in Deutschland noch
als `heilig‘ galten.
Dort traten 1994-2000 auf: die „Tiger Lillies“ aus
London, „three seasons troiseme sex“ aus Leutkirch, „Rosi Ledet & her Psydeco
Playboys“ aus Louisiana, „Revolution Number 9“ aus Freiburg, „Bullfrog“ aus dem
Westen „Patent Ochsner“ aus der Schweiz – und sogar Eric „Wrecless“ Goulden, der
„Grandfahter des Punk“. Selbst die „Banana Fishbones“ dröhnten hier. Und etliche
mehr. Manche von ihnen kannten mich bereits aus meinen drei Büchern über
„Rockszenen der Oberschwäbischen Privinz“. Erschienen 1987-1998.
Gesamtseitenzahl: 1004.
Doch trotz all solcher Eigenleistungen erinnerten sie
immer wieder an die Bilder meiner Familien-Herkunft: die Berichte über Hans und
Sofie Scholl. Und ihre Geschwister samt Freundinnen und Freunden. Wer waren die?
Wie prägten mich meine Eltern Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher? Vermutlich
eine so eher seltene Position als Sohn
bekannter Eltern. Zumal als Nachfahre von Leuten, die viele als „Helden“
verehren. (So äußerte es zum Beispiel Karl Graf von Stauffenberg über die „Weiße
Rose“.)
Und doch bin ich auch Enkel des Installateurs Anton
Aicher (9. November 1895 – 13. April 1969). Selten öffentlich erwähnt, tauchen
Erzählungen über diesen eigenwillig-mutigen Mann doch immer wieder auf, wenn
sich die zweite Generation nach ihm trifft. Zum Beispiel der Spruch: „Ich bringe
den Feierabend mit.“ Vom Opa wohl gesagt an jenem Tag, als der Vater meines
Vaters (1932?) von seiner Arbeitsstelle entlassen worden war. Das sollte ihm
nicht noch einmal passieren. Von da an bestritt er „selbständig“ sein Einkommen.
Später sogar als Chef der „Weltfirma“ „Aicher & Schmid“ – wie’s mir mal ein
Memminger Installateurmeister respektvoll sagte. Und mit klarer Haltung. Anton
Aicher und seine direkte Familie in der Glockengasse 10 in Ulm-Söflingen
gehörten 1933-1945 nicht Hitlers Nazipartei NSDAP an. Den I. Weltkrieg
(1914-1918) hatte Anton Aicher selbst als Soldat mit erlebt. Einen zweiten
wollte er nicht.
Sein Friedenswille scheint Anton Aichers Familie nicht
wirklich geschadet zu haben. Denn kurz vor seinem Tod ragte über die Dächer der
Ulmer Weststadt ein mehrstöckiges Gebäude auf. Oben dran mit weit sichtbaren
Lettern: „Aicher & Schmid“. Beim Schreiben dieser Zeilen wächst in mir die
Erinnerung an die Zusammenarbeit mit einem kleinen Immobilien- und Solarbüro
zwischen 2000 und 2010 - schräg gegenüber dem vergeichsweise wuchtig
Aicher’schen Mehrstöcker an der gleichen Söflinger Straße.
Das Büro arbeitet dort nicht mehr, aber
das von Anton Aicher mit-begonnene (und wohl von Max Bill geplante)
Mehr-Etagen-Haus steht noch in Besitz einer Enkelin des Handwerksunternehmers –
wenn auch ohne Schriftzug „Aicher und Schmid“.
Ja – da war sogar noch mehr: Anton Aicher soll Anhänger
des „Schwundgeld“-Entwicklers Silvio Gesell gewesen sein. „Ich weiß nicht – aber
manchmal glaube ich, unser Opa Anton wohnt inzwischen in meinem Geldbeutel. Fast
immer wenn was drin ist, ist es schon wieder weg“, meinte ich um 2019 mal
augenzwinkernd zu meiner Cousine Elisabeth.
Zufall also, dass sowohl meine beiden Brüder als auch
ich die meiste Zeit unseres Berufslebens bisher `selbständig‘ gearbeitet haben?
Und: Wir alle drei waren von unserem Vater Otl Aicher dazu angehalten worden, im
hiesigen Anwesen Rotismühle (südwestlich von Memmingen) bei hand(werklicher)
Arbeit mit zu helfen. Deshalb auch leichter „mit der Hand zu denken“, wie es
mein Papa mehrmals sagte? Auf den meisten selbst gepflasterten Bereichen dieses
Areals herrschte Parkverbot. Außer den Fahrzeugen der Eltern, ausnahmsweise ganz
wichtiger Kundinnen oder Kunden – und (wie selbstverständlich) der Handwerker,
die hier immer wieder zu tun hatten. Mein Vater lud sie fast jedes Jahr einmal
alle in den Saal „rotisserie“ zum Essen ein. Handwerk war ihm (fast) heilig.
Mir blieb der Respekt. Hochachtung vor denen, die
(manchmal mehr) als acht Stunden eines Tages körperlich vergleichsweise
anstrengend arbeiten. Und gelegentlich mal der eigene Griff zum Werkzeug – wenn
auch oft nicht der vollständig geübte.
Und dann manchmal doch der zupackende: In den 1990er
Jahren hieß es mal während eines Fests von und mit Behinderten in unserer
Rotismühle: Das Klo ist verstopft. Samstagnachmittag – wo da handwerkliche Hilfe
herholen? Da fiel er mir wieder ein, der Rat von meiner Oma Anna Aicher (11. Mai
1895 – 11. August 1980): In solch einem Fall einen stabilen „Stecken“ (also
Stock) nehmen, „einen Lumpen fest rumwickeln“ – und damit den Ausfluss der
(etwas mit Wasser gefüllten) Toilettenschüssel kräftig „pumpen“. Gehört,
gelernt? Es kam auf ein Versuch an. Erfolgreich. „Leute, wir können
weiterfeiern. Der Kloabfluss ist wieder frei“, sagte ich der Festgemeinde –
zufrieden mit dem Geschafften.
Tipps, Vorbilder, Erzählungen: Was die Älteren da uns
Nachwachsenden beigebracht hatten, wirkt nach. Vielfältig. Bis in den eigenen
Alltag `rein.
Mehr noch: Fast direkt nach Schreiben dieser Zeilen die
Erinnerung an meine Klein-Kind-Zeit. Da ließ sich in unserem Haus am Ulmer
Hochsträß 20 (einem Lehrer-Gebäude der „Hochschule für Gestaltung“) die
Klospühlung nicht zurück zum „Stopp“ bringen. Angst vor dem Überlaufen der
Toilettenschüssel? Auf jeden Fall Alpträume davon. Spätestens jetzt, nach
eigener Reparatur des Klo-Abflusses in Rotis während des Fest in den 1990er
Jahren wirkten diese Ängste wie weggespült. Therapie dank dem Tipp von meiner
Oma Anna Aicher.
Lange Linien. Vielfältig prägend. Auch die eigene
Arbeitswelt. Beim Buch „Weiße Rose“ blieb es nicht. Meine beiden Eltern
veröffentlichten nach 1952 weitere Bände. Daher wohl nicht ganz verwunderlich,
dass auch wir drei Söhne uns an solche Aufgaben wagten? Mit Gottes – und anderer
Leute – Hilfe könnte ich 2021 mal wieder einen gedruckten Band `rausbringen.
Lange Linien. Mal kurvig. Auch mal verkreuzt. Und nicht
immer auf den ersten Blick nach zu verfolgen.
Aber: Sie prägten mich, banden mich ein – sicherten
vielelicht auch? Offenbar lange -
und daher immer wieder erkennbar. Grundlegender als zum Beispiel
begrenzende Vorgaben mancher, die selbst
besser zu wissen glauben, was demokratisch und „anständig“
ist. 2020 stand auf Plakaten mein Name
als Redner bei Veranstaltungen für die im Grundgesetz garantierten Grundrechte.
Da beschimpftem manche die Veranstalter – und mich - wegen „historisch
politischer Erbschleicherei“.
Solche Vorhaltungen hatte ich zuvor nie gehört oder
gelesen, wenn ich an offiziellen Gedenkveranstaltungen teilnahm. Oder auch an
Schulstunden. Offenbar kommt es sehr darauf an, ob das „historisch politische
Erbe“ der Verehrung der Staatsverwaltung und ihren Geldempfängern dient – oder
eben „nur“ den Grundrechten, die das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
nennt
An diese Grundrechte zu erinnern, und sie zu wahren,
scheint mir tatsächlich eine der längeren Traditionslinien meiner
Herkunftsfamilien zu sein. Unter anderem angelegt von meinen Eltern Inge
Aicher-Scholl und Otl Aicher.
Zum Beispiel beeinflusst vom politischen Verhalten
meiner Mutter. Obwohl Volkshochschul-Mitgründern und 1946-1974 Leiterin einer
öffentlichen Einrichtung, organisierte Inge Aicher-Scholl in den 1960er Jahren
die „Ostermarsch“-Demonstrationen gegen Rüstung und Krieg in Ulm.
1963 gehörte sie in der Donaustadt zu
jenen, die sich gegen die geplanten „Notstandsgesetze“ aussprachenen. Zusammen
mit zwei vergleichsweise jungen Richtern – darunter ihrem Schwager Fritz
Hartnagel (4. Februar 1917 – 29.
April 2001). Sie äußerten ihren Protest öffentlich – zum Beispiel mit 30.000
Flugblättern. 1963 – kurz nach der
„Kubakrise“ vom Oktober 1962, die die Welt ziemlich nahe an den Abgrund eines
Atomkriegs geführt hatte.
Bundesinnenminsister Herman Höcherl (CSU) soll sich 1963
bis ins benachbarte Neu-Ulm vorgewagt haben, um über die „Freiheitsfanatiker“
von Ulm zu lästern. Ja – meine Eltern ließen sich 1985 sogar zur „Sitzblockade“
auf der Straße zum Atomwaffenlager Mutlangen nieder. Die Polizei trug meine
Mutter weg. Das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd verurteilte sie deswegen zu 800
Mark Strafe. Mutiges Auftreten für wichtige politische Ziele.
Jahre später hob das Bundesverfassungsgericht das Urteil
auf: Sitzen auf der Straße sei keine „Nötigung“.
Andererseits: Benno Grzimek - ein guter Freund der
Familie Aicher - sagte zu mir: „Deine Mutter ist schon manchmal sehr ängstlich.“
Anlass: Sie hatte ihn gewarnt: „Fall‘ die Treppe nicht runter!“ Dabei kannte er
den Weg zum Keller seit Jahren. „Auch Du hast manchmal mehr Angst als nötig“,
erklärte mir Benno später. Ein „Feuerlauf“ einige Wochen danach auf über 500
Grad heiß glühendem Holz sollte dagegen helfen.
Ich hätte „Nerven wie Drahtseile“. So zumindest
schrieb‘s mir eine journalistische Freundin im Herbst 2020. Zuvor hatten mich
Zeitungen angegriffen, weil ich 2020 als
„Sohn von Inge Aicher-Scholl“ oder „Neffe von Sophie Scholl“ als Redner bei
Kundgebungen angekündigt worden war. Bei öffentlichen Versammlungen für
Grundrechte. Meine fast rück-fragende Antwort an die Schreiberin: „Vielleicht
wegen der Resilienz aus Familientradition?“
Lange Linien also? Mehr dazu in dieser Rubrik „Lange
Linien“. Ab jetzt, 22. April 2021,
voraussichtlich immer ab da wieder hier.
Demnach schon am oder bis 29. April 2021 geht’s hier mit
einem neuen Text weiter.
Oder gar früher?
Vielleicht dann auch mehrmals pro Woche?
|
Text 01 vom 22.04.2021
|
|
Text 02 vom 02.05.2021 |
| Text 03 vom 06.05.2021 |
Text 2
„Fangen wir an“
„Fangen wir an.
Hier in Ulm“. Diese Aufforderung meiner Eltern Otl Aicher und Inge
Aicher-Scholl gilt manchen fast als eine Art Grundsatz-Parole.
Entstanden in den ersten Jahren nach dem II. Weltkrieg (1939-1945). Also
in einer Zeit, da die Donaustadt großenteils in Trümmern lag. Ruinen
nach furchtbaren Bomben-Nächten.
Wie oft
erzählten mir meine Mama und mein Papa von den Glühbirnen, die sie nach
frühen Vorträgen ab 1946 in der „vh ulm“ (der „Ulmer Volkshochschule“)
aus den Fassungen drehten und mit Heim nahmen, damit sie nicht geklaut
würden.
Also nach
Informationsabenden jener „vh ulm“. Also der „Ulmer Volkshochschule“,
die meine Mutter Inge Aicher-Scholl 1946 mit gründete – und bis 1974
leitete. Übrigens: ohne eigenes Abitur.
Die Zeit nach
dem Kriegsende 1945. Für meine Eltern offenbar eine spannend-belebende.
Neubeginn.
„Fangen wir
an.“ Los geht’s hier im Text mit ein paar einführenden Hinweisen.
Da trafen sich
zwei Familien in den ausgehenden 1930er Jahren. Kennengelernt hatten
sich zwei Söhne dieser Sippen als Oberschüler in Ulm: Werner Scholl und
Otl Aicher.
Beide Familien
gehörten zunächst nicht zur Ulmer Prominenz. Sie waren erst nach dem I.
Weltkrieg (1914-1918) in die Münsterstadt gezogen.
Anton Aicher
(9. November 1895 – 13. April 1969) lernte Anna Maria Kurz (11. Mai 1895
– 11. August 1980) als Soldat wohl nach dem I. Weltkrieg (1914-1918)
kennen. Als Kamerad von Annas Bruder berichtete Anton Aicher bei seinem
Besuch in ihrem damaligen Wohnort Illerrieden südlich von Ulm vom
Kriegstot des Gefallenen.
Anna und Anton
entschieden sich
f ü r das
Leben. Sie heirateten 1920 – standesamtlich am 5. Juli und mit
kirchlichem Segen am 6. Juli. Schon gut sechseinhalb Monate später kam
ihr erstes Kind zur Welt: Hedwig (21. Dezember 1920 – 30. Dezember
2020). Es scheint also in den Sommertagen 1920 mindestens einen ziemlich
guten Grund für die beiden gegeben zu haben, vor den Traualter zu
treten.
Es folgten mein
Vater Otto „Otl“ (13. Mai 1922 – 1. September 1991) und mein Onkel Georg
(XX XX 1923 – 30. Juli 2011). Habe ich Berichte der drei – und ihrer
Mutter Anna – richtig verstanden, dann lebte die Familie mehr oder
minder von Anfang an in der Glockengasse 10 in Ulm-Söflingen.
Eine auf dieser
Seite eher locker umbaute Straße. Mit je einem mehrstöckigen Gebäude pro
Familie. Ein paar (Obst-) Bäume, Wiesen, Gemüsegärten. Teils kleine,
eher hauseigene Werkstätten. Nahe der Textilfabrik „Steiger & Deschler“.
Leben zwischen Wohnen und
betrieblich Werkeln. Schaffen fürs Einkommen und Sitzen zum Feierabend –
mehr oder minder an einem Platz. Mein Vater sprach später manchmal von
„Banlieu“ (also das französische Wort für Vorstadt.) Irgendwo zwischen
gut- und kleinbürgerlich?
Für das „klein“
mag manche Erinnerung von meinem Papa gesprochen haben. Etwa an
Krisenzeiten. „Meine Mutter wollte mit uns ins Wasser gehen“, erzählte
er uns mehr als einmal. In die nahe Blau. Nein – nicht zum Baden, eher
zum Sterben. Das passt zur Ansage seines Vaters „Ich bringe den
Feierabend mit“ über seine Entlassung. Wohl 1932. Für ihn dann Anlass
dazu, sich wirtschaftlich auf eigene Beine zu stellen. Mit
Firmengründung „Aicher & Schmid“.
Hinweis auf
einen dann doch stärkeren Überlebenswillen? Auch wenn „der Weg hart und
steinig“ war, wie Anna Aicher in kleinen Ansprachen bei Familienfeiern
ein paarmal berichtete. Bevor sie 85jährig starb, hieß es gelegentlich
bei Gesprächen in der Familie, die Oma habe gesagt: „Jetzt ist genug.“
Mehrmals sei deshalb auch schon ein Pfarrer zur „letzten Ölung“ an ihr
Krankenbett zu Hause bestellt worden. Darüber
eher schmunzelde Berichte im engeren Familienkreis. Ein langes Leben –
und dann ein ersehnter Tod. Katholisch begleitet. In Gottes geborgenen
Händen.
„Wann kommt denn jetzt die Straßenbahn?“
Wie wenig
dramatisch das gesegnet gealterte Sterben meiner Oma väterlicherseits
wirkte, zeigt sich an meiner Erinnerung von ihrer Beerdigung auf dem
Söflinger Friedhof im August 1980. Wir Trauergäste warteten vor der
Totenkapelle auf den wohl bald ausgefahrenen Sarg. Über uns die
Wellblech-ähnliche Abdeckung des Vordachs. Mit etwas Phantasie ließ sie
sich mit einer öffentlichen Haltestelle vergleichen. „Wann kommt denn
jetzt die Staßenbahn?“, fragte darunter lächlend mein Onkel Fritz
Hartnagel (4. Februar 1917 – 29. April 2001) meinen Bruder Florian.
Beide standen leicht schmunzelnd hinter mir. Ich musste mich
berherrschen, dass ich nicht laut zu lachen begann.
Ein natürlicher
Tod, der zum Leben gehört. Ja sogar in seinen letzten, eher kränkelnden
Jahren herbeigesehnt von der dann Verstorbenen. Teil einer Famlie, deren
Mitglieder alle bis zu solch einem „natürlichen Tod“ lebten. Mit einer
Ausnahme: mein Vater Otl Aicher. Er erlag am 1. September 1991 den
Folgen eines Verkehrsunfalls. Ähnlich wie meine Schwester Pia (3.
Oktober 1954 – 25. Februar 1975). Wer weiß, ob die beiden deshalb heute
als Teil einer „Risikogruppe“ bezeichnet werden würden?
Vielleicht umso
mehr, wenn dabei auch die Familie meiner Mutter Inge Aicher-Scholl ins
Blickfeld genommen wird. In ihr verloren seit 1943 drei Mitglieder ihr
junges Leben: Hans Scholl (22. September 1918 – 22. Februar 1943), Sofie
Scholl (9. Mai 1921 – 22. Februar 1943) und Werner Scholl (vermisst seit
7. Mai 1944 in Russland). Wohl alle „unnatürlich“.
Gewaltsam
erzwungenes Sterben. Und doch auch Überlebenswille. Oder gerade
deswegen? Meine Mutter erzählte mir, nach der Ermordung ihrer
Geschwister durch die Nazi-Justiz am 22. Februar 1943 habe ihr Vater
Robert gesagt: „Jetzt schneiden wir uns alle die Pulsadern auf.“
Aus Protest gegen das erlittene Unrecht. Seine Frau Magdalena (5.
Mai 1881 - 30. März 1958)
soll erwidert haben. „Von wegen! Das wäre doch genau das, was die
wollen. Jetzt essen wir erst mal `was.“
(Mit Lebensmittel aus dem eigenen Gemüsegarten in Neu-Ulm?)
Dieser
Ratschlag „Jetzt essen wir erstmal `was“ fiel im Haushalt von meiner
Frau und mir auch schon mal, wenn staatliche Stellen versuchten, uns mit
Drohungen ein zu schüchtern. Etwa mit erkennbarem Ziel, die hiesige
kleine Wasserkraftanlage Rotismühle aus zu bremsen. Keine Frage:
Nazi-Diktatur 1933-1945 und Bundesrepublik Deutschland (seit 1948) –
zwei völlig unterschiedliche Regierungssysteme.
Was klar Unterschiedliches. Aber
markante Ratschläge aus der Familiengschichte – vielleicht auch noch
Jahre später im Extremfall ermutigend.
Liebe fürs
Leben. Gegen das Gemetzel des I. Weltkriegs (1914-1918) hatte sich mein
Opa Robert Scholl schon während dieser Zeit entschieden. Er leistete
seinen Wehrdienst als Sanitätsoldat ab. Dabei lernte er die Diakonisse
Magdalena Müller kennen. Zehn Jahre älter als er. Sie heirateten 1916.
Sowohl von ihrem ersten Kind Inge als auch von meinem Großvater Robert
Scholl selbst hörte ich immer wieder, dass er nach 1919 nicht zu
denjenigen Deutschen gehörte, die den „Versailler Vertrag“ als
„Schanddiktat“ empfanden. In Harold Nicolsons Buch „Friedensmacher 1919“
(Originaltitel: „Peacemaking 1919“) – „fünfte und sechste Auflage 1934“
(…) „by S. Fischer Verlag A – G / Berlin“ steht der handschriftliche
Eintrag: „Meinem lieben Julian zur Erlangung geschichtlicher Wahrheit!
Dein Opa Robert Scholl, München 20. März 1972“.
Was da
politisch mit Ausrufezeichen zum Frieden mahnt, prägt auch meine
persönliche Erinnerung an meinen Großvater Robert Scholl. An „männliche“
Herrschaftszeichen – wie etwa lautes Brüllen oder das bedrohliche
Hand-Heben – kann ich micht nicht entsinnen. Eher schon freundliches, ja
vielleicht sogar gütiges Lächeln, wenn ich als Kind Opa und Oma in
München besuchen durfte. Dann nicht mehr Magdalena Scholl, sondern
Robert Scholls zweite Frau Anne Scholl (* Plank ?).
8. Mai 1945.
Tag der Befreiung. Was bedeutete das für meine Herkunftsfamilien? Meine
Tante Hedwig Maeser (* Aicher) schilderte es meiner Frau Christine
Abele-Aicher und mir bei Gesprächen 2011/2012 so: „Alle Menschen sind
sich wieder näher gekommen. Man musste vor dem anderen nicht mehr
vorsichtig sein. Da ist man auf einmal aufgeblüht.“ (So nach zu lesen in
Christines Buch „Die sanfte Gewalt. Erinnerungen an Inge Aicher-Scholl“.
Mehr dazu unter
www.ingeaicherscholl.de).
Im Juni 1945
ernannte die amerikanische Militärverwaltung Ulms meinen Großvater
Robert Scholl (13. April 1891 – 25. Oktober 1973) zum Oberbürgermeister
von Ulm. Also einen, der schon mal ein Rathaus geleitet hatte – und als
Gegner der Nazis bekannt geworden war. Habe ich es richtig gelesen, dann
sorgte er dort unter anderem dafür, dass vergleichsweise viele der stark
zerbombten Häuser schneller wieder bewohnbar wurden als Gebäude in
anderen württembergischen Städten. Und: Mit dem, was von seiner Familie
noch übrig war, kümmerte sich mein Opa mütterlicherseits unter anderem
um die Zehntausende von Flüchtlingen, die nach Ulm kamen.
Drei damals
nicht mehr ganz junge Damen erzählten mir (wohl 2009), dass Robert
Scholl sie und ihre Familien persönlich besucht habe, um nach zu
schauen, ob es ihnen in den neuen Wohnräumen gut gehe. Denn die Gewölbe
dort waren ursprünglich (1881-1887 gebaut) nicht als dauerhafte
Unterkünfte für ziviles Leben entstanden: die „Kehlkaserne“ des „Fort
Oberer Eselsberg Nebenwerk“ (nahe dem „Oberberghof“) Ulm. Solche Plätze
galten im schwer bombardierten Ulm ab Mai 1945 als besonders wertvoll.
So soll etwa ein Brauereichef
im nahen „Fort Unterer Eselsberg“ seinen Platz gefunden haben.
„Macht doch Eure eigene Schule“
In dieser
Stimmung zwischen dem Ende starker Zerstörungen und einem Neubeginn
übernahmen Inge Scholl und deren Freund Otl aber auch noch ganz andere
Aufgaben: für einen kulturellen Neubeginn.
Ob es mit dem
Fahrrad, per Motorrad oder am Steuer von Anton Aichers „Holzvergaser“
gewesen war - oder mehrmals in
jedem dieser Vehikel: Otl Aicher fuhr von Ulm nach Mooshausen (heute
Kreis Biberach). Sein Reiseziel: Romano Guardini (17. Februar 1895 – 1.
Oktober 1968). Der Pfarrer, der sich selbst als „katholischer Demokrat“
bezeichnete, hatte sich während der Nazi-Diktatur in das oberschwäbische
Dorf zu seinem befreundeten Kollegen Josef Weiger zurückgezogen. Die
damals ländlich konservativ-katholische Gegend bot sich wohl zur
„inneren Emigration“ an.
Mein Vater lud
Guardini 1945 zu Vorträgen in die evangelische Martin-Luther-Kirche nach
Ulm ein. Diese Ansprachen Guardinis gelten als erste Vor-Veranstaltungen
der damals neuen „vh ulm“, „Ulmer Volkshochschule“. 1946 mit begründet
von Inge Scholl – und von ihr bis 1974 geleitet. Romano Guardini traute
meine Eltern am 7. Juni 1952 in München, „St. Anna“. Einen Monat zuvor
war Inge Scholls Buch „Die Weiße Rose“ erschienen. Danach nannte sie
sich „Inge Aicher-Scholl“.
Ulm 1945. In
vielen Bereichen schwer kriegs-zerstört. Dazu kamen kalte Winter. Zeit,
aus zu wandern, um woanders schöner wohnen zu können? Und wärmer? Mein
Papa berichtete mir, damals sei er in die Schweiz gefahren (wohl nach
Zürich). Dort kaum zu erkennen: Kriegs-Schäden an Häusern. Danach sei er
wieder heim nach Ulm gereist. Die eigene Stadt wieder mit aufbauen – so
sein Ziel. Selbstverständlich? Vermutlich nicht ganz. Denn während des
„III. Reichs“ (1933-1945) hatte Otl Aicher versucht, seine
Schwimmfähigkeit so zu trainieren, dass er unbeachtet den Rhein hätte
durchquernen können. Zielpunkt: Schweiz.
Nach dem 8. Mai
1945: „Fangen wir an, hier in Ulm.“ Eine beinahe Hände reibend
zupackende Losung meiner Eltern. Zwar kann ich mich nicht daran
erinnern, sie jemals wörtlich von meiner Mutter und meinem Vater gehört
zu haben. Aber doch immer wieder Berichte über die Aufbruchstimmung kurz
nach dem 8. Mai 1945. Seien es die Glühbirnen, die nach
Vorttrags-Abenden der „vh ulm“ aus den Fassungen gedreht wurden – damit
sie danach niemand mitnehmen konnte.
Seien es Fahrten, um Rednerinnen oder Redner zu deren Vorträgen
in die Volkshochschule ab zu holen. Auch mal während starkem
Schneegestöber. Seien es Gasthaus-Besuche mit den Referienden nach den
Vorträgen. Ein Hunger auf Zukunft. Erkennbar hielt er Jahre lang an.
Denn 1953 waren Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher als treibende Kräfte
mit dabei, als in den Räumen der „vh“ die ersten Kurse der neu
gegründeten „Hochschule für Gestaltung“ (HfG) begannen. Was sie lehrte,
hieß später in den USA „verulmen“.
„Macht doch
Eure eigene Schule!“. Wenn vor allem mein Bruder Manuel und ich in den
Aicher’schen Wohnräumen der Rotismühle während der 1970er über wenig
Erfreuliches aus dem Gymnasium Leutkirch berichteten, meinte mein Vater
manchmal: „Macht doch Eure eigene Schule!“. Wir schüttelten dann den
Kopf. Und taten’s später doch einmal öffentlich. Mit Schulfreundinnen
und -freunden. In Form einer selbst organisierten Tagung von Schüler-
und Jugendzeitungen im Frühjahr 1978 in der Grundschule
Leutkirch-Engerazhofen. Die Staatsverwaltung empfand das offenbar als
bedrohlich. Sie ließ anschließend ihre Geimpolizei „Verfassungschutz“
ermitteln. Da aber hatte uns bei dieser Tagung mindestens ein älterer
Kollege schon erläutert, was das Presserecht erlaubt – und was nicht.
Diese
Grundkenntnisse – vom „Wochenblatt“-Redakteur
Gunter Schieferdecker aus dem Verlagshaus der Ulmer
„Südwest-Presse“ in weniger als zwei Stunden so spannend wie
unterhaltend vor einem markant aufmerksamen jungen Publikum vorgetragen
– blieben mir als Rüstzeug für mein teils journalistisches Arbeitsleben.
Offenbar bewährt. Denn seither hat mich niemand wegen meiner
Presseartikel vor Gericht gezerrt. So stark kann lebhaftes Lernen
wirken. Ohne „Kultus“-Bürokratie. Und ohne Spaßbremse.
Rotismühle,
Frühjahr 2021. Ein paar Kinder stapfen ein-, zweimal übers Gelände. Sie
sollen künftig öfter hier zu sehen sein? Unterrichtet durch die „Freie
Schule Allgäu“? Adresse: Rotis 7. Näher an Blumen, Bäumen und Bienen als
an Bildschirmen? Jetzt in
jenem „böhmischen Gewölbe“ aus
der Zeit um 1900, das um 1970 nach Plänen Otl Aichers zur Kantine für
sein „büro aicher“ (später: „rotis büros“) umgestaltet wurde. Damals
„rotisserie“ genannt. Und damit auch jener Saal, in dem während der
1990er Jahre auf Einladung meines Bruders Florian und mir Leute wie die
„alternativen Nobelpreisträger“ Heinz-Peter Dürr und Hermann Scheer
gesprochen hatten. Und etliche mehr. Etwa
nahe lebende Biogasbauern beim Nachmittagskaffe für ihre wissbegierigen
Kolleginnen und Kollegen. Dabei auch der gleiche Ort, an dem in den
1990ern Rockkonzerte Rotis belebten.
Anhaltend
prägend. Auf das, was ich dabei über sonnig erneuerbare Energien hören
und sehen durfte, kann ich mich heute, 2021, noch zurück besinnen. Als
Grundlage immer wieder dann, wenn ich über solch günstig heimische
Kräfte berichten darf.
Wissen – erworben von Wissenden. Und bestärkt dann auch durch handfeste
Erfahrungen mit dem eigenen Wassertriebwerk in der Rotismühle. Mit
gelegentlichem Selbst-Handfest-Zupacken – während der Jahre in Hunderten
von Arbeitsstunden.
Also doch „eigene Schule“?
Alte Aufforderungen unserer Eltern – vielleicht bald aktueller denn je?
Neue Wege? (Not-?-)Ausgänge aus einem „Schulsystem“, von dem
Hirnforscher während der jüngsten Jahre (mehr als ein)mal behaupteten,
etwas Wesentliches finde dort in späteren Klassenstufen eher nur
ausnahmsweise statt: Lernen
fürs Leben? Stattdessen bald in Rotis Eigeninitiative junger Eltern –
und Offenheit meiner Brüder als heutiger Raum-Eigentümer? Lernen in
einer Umgebung, in der manch Schönes blüht. Heute sichtbar – auch noch
in 20 Jahren? Bald, 2021, ein Anfang. Hier in …
Text 3
Im Schatten
„Vom
Verfassungsschutz beobachtet“. Dieser Hinweis in „Qualitätsmedien“ soll
offenbar die so Überwachten als Staatsfeinde brandmarken. Meine
Herkunftsfamilie stand schon öfter auf der Spähliste solcher
„Schlapphüte“.
(Leutkirch)-Rotismühle. Wohl Mitte der 1970er Jahre. Am Esszimmertisch
der Familie Aicher. Unser Vater Otl Aicher erzählt, er habe vor ein paar
Tagen Post von einer Behörde bekommen. Inhalt: Meinem Papa sei es
diesmal nicht erlaubt worden, Luftbilder anzufertigen. Begründung: Er
habe (mit anderen) während der „`Spiegel‘-Affaire“ 1962 eine Erklärung
für den damals verhafteten „Spiegel“-Herausgeber Rudolf Augstein
unterschrieben.
Inzwischen, so
mein Vater am aicher’schen Esstisch in Rotis damals in den 1970ern,
liege ihm aber die amtliche Fotografier-Genehmigung vor. Wie das? Dazu
erklärte uns unser Papa, er habe der Behörde sofort geantwortet:
Entweder liegt mir morgen Eure Genehmigung vor – oder Euer
Verbots-Geschreibsel übermorgen dem „Spiegel“.
„Jetzt weiß ich
wenigstens, dass ich bei denen in den Akten stehe“, sagte mein Vater uns
Aicher-Kindern damals am Tisch. Seinem Ruf als guter Fotograf hat’s
offenbar nicht geschadet. Zusammen mit der „Lufthansa“ veröffentlichte
er die Bücher „Flugbild Deutschland“ und „Im Flug über Europa“.
Der CDU
- schon damals Regierungspartei in Baden-Württemberg –
verweigerte er allerdings die Rechte, seine Luftfotos zu verwenden. Aus
Ärger über den Verbotsversuch. Die Dauer-Regierer mussten ohne Überblick
auskommen.
"Fragen Sie doch die Aichers"
Beobachtet von
der staatlichen Geheimpolizei – überwacht von Kontrollbehörden. Das
erlebten die Familien Scholl und Aicher immer mal wieder.
Zum Beispiel
1978. Im Frühjahr `78 luden wir von der Leutkircher Schülerzeitung
„Radieschen im Untergrund“ ein. Und zwar zu einer Wochenende-Tagung der
Jugend- und Schülerzeitungen der Gegend. Von Ulm bis Konstanz. Als
freier Mitarbeiter des Blatts unterstützte ich damals den
verantwortlichen Redakteur, meinen jüngeren Bruder Manuel. Die „Große
Kreisstadt Leutkirch“ bot freundlicherweise als Tagungsort ihre
Grundschul-Gebäude im Teilort Engerazhofen an. Bedingung: zwei
`pädagogisch befähigte‘ Personen sollten während der Veranstaltung
gelegentlich nach dem Rechten schauen. Etwa während der Essenszeiten.
Diese Aufgabe
übernahmen meine Mutter Inge Aicher-Scholl (als ehemalige
Volkshochschulleiterin) und Grund- und Hauptschul-Lehrer Wilhelm
Schwarz. Ihn kannten wir von der „Arbeitsgruppe Friedenswoche Leutkich“.
Ein paar Wochen
(?) nach der Tagung rief Schwarz uns an und erklärte: „Mich holte heute
jemand vom LVA aus dem Unterricht. Ich fragte: `LVA –
Landes-Versicherungs-Anstalt?‘
‚Nein‘, erfuhr ich, ‚Landes-Vefassungsschutz-Amt‘. Die Person
wollte wissen, ob bei Eurer Tagung irgendwelche `verfassungsfeindliche
Tendenzen`erkennbar waren. Ich sagte: `Das weiß ich nicht. Ich war ja
nur beim Mittagessen und abends kurz da. Aber: Fragen Sie doch einfach
die Aichers. Die haben ein Protokoll geschrieben.‘“
Vom
„Verfassungsschutz“ erhielten wir Tagungs-Veranstaltende nie die Bitte
um dieses Protokoll. Allerdings sandte uns die Behörde auch keine
schriftliche Bestätigung, dass es bei unserer Zusammenkunft keine
„verfassungsfeindlichen Tendenzen“ gegeben habe. Genau diese amtliche
Zusicherung forderten wir allerdings vom „Verfassungsschutz“. Mit
direkten Anrufen dort.
Grund unseres
Wunsches: Unter den vielleicht vierzig bis fünfzig (?) Teilnehmenden des
Jugend- und Schülerzeitungstreffens befanden sich vermutlich einige, die
später im „Staatsdienst“ arbeiten wollten. Und diese Leute sollten bei
künftigen Einstellungsgesprächen keine Probleme wegen der Tagung
bekommen.
Doch der
„Verfassungsschutz“ Baden-Württemberg verweigerte diese schriftliche
Bestätigung.
Was also tun?
Wir Schülerzeitungs-Ativen aus Leutkirch informierten diejenigen, die
die Tagung besucht hatten. Und auch Journalistinnen und Journalisten.
Anscheinend waren wir nicht die einzigen jungen Leute, die die
Landes-Geheim-Polizei „Verfassungsschutz“ damals beobachtet hatte.
Mein Vater Otl
Aicher war es wohl, der meiner Mutter Inge Aicher-Scholl deshalb im
Frühjahr/Frühsommer 1978 einen Brief an Landesinnenminister Lothar Späth
(CDU) diktierte. Darin zu lesen: Die Observierung von Schülerinnen und
Schüler erinnere sie an die erste Verhaftung durch die „Geheime
Staats-Polizei“ (GeStaPo) von Hans Scholl, Inge Scholl und Werner Scholl
1937 (?). Und es erinnere sie an die Fahrt von Inge Scholl und Werner
Scholl auf dem offenem Lastwagen-Verdeck der Polizei von Ulm über die
damals neue Autobahn von Ulm zum Verhör nach Stuttgart.
Dieses
Schreiben meiner Mutter an den Innenminister geriet an Journalistinnen
und Journalisten. Und im „Sommerloch“ 1978 griff die „Stuttgarter
Zeitung“ das Thema freudig auf. In einer damals politisch
vergleichsweise „heißen“ Zeit.
Denn
Ministerpräsident Hans Karl Filbinger (CDU) konnte kaum länger leugnen,
noch nach dem offiziellen Ende der Nazi-Herrschaft (am 8. Mai 1945)
Todesurteile für Soldaten gefordert
zu haben, die sich geweigert hatten, weiter für Hitler zu
kämpfen. Der Schriftsteller Rolf Hochhuth nannte Filbinger deshalb einen
„furchtbaren Juristen“.
Am 7. August
1978 trat Filbinger zurück. Und wer sollte sein Amt übernehmen? In
Presse und Funk damals die Namen: Manfred Rommel (Stuttgarter
Oberbürgermeister und Sohn des „Wüstenfuchses“ Erwin Rommel) und
Innenminister Lothar Späth.
Ein
Innenminister, der erkennbar unschuldige Schülerinnen und Schüler
bespitzeln lässt? Geeignet als neuer „Landesvater“ in einer Zeit, da man
gerade erst den „furchbaren Juristen“ Filbinger losgeworden war? Diese
Frage stellte sich offenbar auch die „Stuttgarter Zeitung“.
Fast noch wie
gestern in mir die Erinnerung an jenen Sommer-Mittag 1978 im Rotiser
Büro meiner Mutter. Wohl mein Bruder Manuel, mein Vater und ich standen
da, während meine Mama am Telefon von einer Journalistin der
„Stuttgarter Zeitung“ befragt wurde.
Es verging
anschließend wohl keine Viertelstunde, da klingelte nochmal das Telefon
im mütterlichen Büro neben der aicher’schen Küche. Diesmal am anderen
Ende der Leitung: Innenminister Lothar Späth. Er bekannte, er habe Inge
Aicher-Scholl schon länger anrufen wollen. Es komme „natürlich“ nichts
über die Jugend- und Schülerzeitungs-Tagung in die Akten. Meine Mutter
zeigte sich im Ton dankend freundlich.
Kaum hatte sie
den Hörer aufgelegt, meinte mein Vater zu uns beiden Söhnen: „Und ab
jetzt führt ihr Telefonate in dieser Sache
a u ß e r h a l b
von hier.“
Dass solches
Ausweichen in öffentliche Telefonzellen vor dem Abhören hauseigener
„Fernsprecher“ als `was nicht ganz Außergewöhnliches galt, erfuhr ich
erst Jahrzehnte später. So soll Bundeskanzler Helmut Kohl gelegentlich
seinen Fahrer nahe von Telefonzellen angewiesen haben: „Halt‘ mal da an.
Ich muss noch was besprechen.“
Noch direkter?
Meine Nachrichten-Übermittlung funktionierte 1978 auch mal ganz ohne
Telefondraht. Morgens kurz nach Sonnenaufgang in Rotis aufs Fahrrad.
Richtung West: Bodensee. Aufregend angenehm der Wind im Gesicht bergab
die Schlierer Straße in Ravensburg -
runter ins Schussental. Noch vor Unterrichtsschluss erreichte ich die
Aktiven der Schülerzeitung in Radolfzell.
Dass mir eine der Redakteurinnen dort besonders gut gefiel, mag
das Reisetempo auf dem Drahtesel mit beschleunigt haben.
Landeserkundung, Liebe und Verfassungstreue – was sich nicht alles
vereinen lässt!
„Bildet Euch
doch da nicht so viel drauf ein.“ Diesen Rat meines älteren Bruders
Florian an uns Schülerzeitugns-Leute ergänzte er mit einem weiteren
Bericht über geheim-polizeiliche Beobachtungs-Methoden. In den frühen
1970er Jahren habe er mit anderen jungen Leuten, die erkennbar gerne
protestierten, bei einer vertraulichen Besprechung verabredet: „Wir
vereinbaren übers Telefon ein Demonstration am Münsterplatz, die dann
gar nicht stattfindet. Mal sehen, ob die Polizei trotzdem dazu
erscheint.“ Gesagt, getan. Nach der Telefonrunde setzten sich die jungen
„Revoluzzer“ gemütlich in ein Café mit Blick über den Münsterplatz. Sie
trauten wohl ihren Augen kaum, als tatsächlich einige Polizei-„Wannen“
vor der großen Kirche Ulms auffuhren – genau zu dem Zeitpunkt, als die
Schein-Demonstration per Telefonkette verabredet worden war.
„Buhhh“. Im
November oder Dezember 2020 durfte ich bei einer Kundgebung für
Grundrechte in Lindau eine Rede halten. Dabei berichtete ich, dass in
Baden-Württemberg ab jetzt die „Querdenker“ vom „Verfassungsschutz“
beobachtet werden sollten. „Buh“-Rufe aus dem Publikum. Darauf ich am
Mikrofon: „Moment. Ich finde das gut. Denn dann können die `Schlapphüte‘
bei unseren Demonstrationen lernen, wie freundlich und friedlich
Demokratie wirklich ist. Und: Wir können sie beobachten. Also:
Beobachtet die Beobachter!“ Ähnlich, wie wir’s 1978 nach unserer
Jugendzeitungstagung tatsächlich gemacht hatten.
Es freut mich,
dass der Stuttgarter Unternehmer und
„Querdenken“-Gründer Michael Ballweg die Sache gütig lächelnd
ganz ähnlich bewertet hat. Er ließ im Frühjahr 2020 beim
Bundesverfassungericht das Recht der Bürgerschaft auf freie und
friedliche Versammlungen schützen. Sollten jemals wieder alle im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantierten Grundrechte voll
gültig sein, so werden mehr Leute als bisher erfahren, dass dieser Mann
für dem demokratischen Rechtsstaat wahrscheinlich weit mehr Gutes
geleistet hat als die meisten Abgeordneten 2020 zwischen Ostsee und
Bodensee.
Grundrechte.
Wie wichtig sie wirklich wirken, wird sich leider umso mehr zeigen, je
länger sie mißachtet werden. Etwa die Unversehrtheit der eigenen
Wohnung. Oder das Brief- und Fernmeldegeheimnis. Und auch „die Würde des
Menschen“.
"Rufmord"?
Die, die es
erkennbar immer wieder brechen – und sich dann auch noch widersinnig
„Verfassungsschutz“ nennen – können mit ihrem un-heimlichen Tun nämlich
beachtlichen Schaden anrichten. Und Lebensgrundlagen bedrohen. Siehe
zehn „NSU-Morde“. Was wusste der „Verfassungsschutz“ davon? Standen
einige der V-Leute nahe, als manche der Taten verübt wurden?
Tatsächlich
bedroht von geheimer Beobachtung fühlten sich allerdings auch mal meine
Eltern Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher. Und offenbar ganz zu Recht.
Gefährdet
schienen ihre Pläne, in Ulm eine „Hochschule für Gestaltung“ (HfG) zu
gründen, durch ein „Geheimbericht über 18 Punkte“. Diesen hatte das
„Landesamt für Verfassungsschutz“ 1951 einem Landtagsabgeordneten
überreicht. Inhalt: Vorwürfe gegen meine Mutter und meinen Vater.
Verfasst von Albert Riester. Nach Angaben meiner Mutter sei Riester „als
Student maßgeblich an der Verfolgung ihrer Geschwister beteiligt“
gewesen. Nach dem II. Weltkrieg (1939-1945) schrieb Riester unter
anderem für die „Ulmer Nachrichten“. Dort empfand man ihn 1951 als
„untragbar“. Begründung: Die Staatsanwaltschaft Ulm beschuldigte
Riester, 1939 einen jüdischen Kaufmann vor den
Nazi-Terror-„Volksgerichtshof“ gebracht zu haben.
Zufall, dass
der ehemalige Verbindungsmann der „Geheimen Staats-Polizei“ (GeStaPo)
der Nazis gerade 1951 eine „Rufmordkampagne“ gegen meine Eltern begann?
Unterstützt vom Stuttgarter „Landesamt für Verfassungsschutz“ ?
Nach Riesters Report sollen meine
Eltern kommunistische Agenten gewesen sein. Meine Mutter erzählte mir
dazu: „Es hieß da, Otl sei ab und zu heimlich nach Prag gefahren, um
dort neue Anordnungen der Russen zu erfahren. Aber: Dein Vater war nie
in Prag. Sein ganzes Leben nicht.“
Wer’s genauer
wissen möchte, möge nachlesen in „hfg ulm. der blick hinter den
vordergrund. die politische geschichte der hochschule für gestaltung
1953-1968“. Was der Kölner Professor René Spitz dort über Riester und
seine „Verleumdungsschrift“ gegen meine Eltern berichtet, liest sich
gerade heute (2021) wie ein Krimi.
Riesters Rache
gegen meine Eltern ließ sich abwehren. Gerade noch. 1953 begann die
„Hochschule für Gestaltung“ mit ihrer Arbeit. Der ehemalige
„Gestapo-V-Mann Riester“ erlitt freilich keine Strafe für seinen
Rufmord-Versuch. Ganz im Gegenteil: Albert Riester „wurde Mitarbeiter
des Verfassungsschutzes, dann Sicherheitsbevollmächtigter der
Daimler-Benz AG und erhält 1994 das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse“.
So stands im „Spiegel“ Nummer 9 von 2003.
Aus Mutters
Mund? Was erzählte mir als Jungendlicher in den 1970er Jahren Inge
Aicher-Scholl über diese Bedrohungen der Ulmer Hochschulgründung? Da
hörte ich von einem „GeStaPo-Spitzel“ namens Riester. Er habe Hans und
Sofie verraten - an ihre Mörder. Und Riester sei von Robert Scholl nach
1945 gesagt worden: „Da ist die Tür“. Zuvor habe der GeStaPo-Zuträger zu
meinem Opa angeblich gemeint: „Ja, Herr Scholl, jetzt können wir ja
wieder mit`nander weitermachen.“ Der klare Rausschmiss wohl aus dem
Ulmer Oberbürgermeisterbüro meines Großvaters wirkte eher untypisch für
ihn. Mehr wird ihm das Beckenbauersche „Jetzt sind wir wieder gut
mitnander“ nachgesagt. Wen wunderts, dass Riester nach Rache suchte.
Durch die
Rufmordaktion des ehemaligen GeStaPo-Spitzels 1951 wirkten die
US-amerikanischen Förderer der HfG verunsichert. Meine Mutter erzählte
mir, sie sei deshalb vom CIC zum Verhör vorgeladen worden. Also dem
Vorgänger des späteren US-Geheimdienstes CIA. Freundlich und sachlich
habe sie die Anschuldigungen Riesters widerlegt. Erkennbare
Zufriedenheit bei den US-Befragern. Dann hörte Inge Scholl wohl von
ihnen: „Wie empfanden Sie denn jetzt gerade unser Gespräch?“ Ihre
Antwort: „Na ja, ein bißle habe ich mich da schon an die Verhöre der
GeStaPo erinnert.“ Darauf die US-Befrager: „Was glauben Sie denn, wie
wir mit den Kommunisten umgehen!“
Diese Berichte
von meiner Frau Mama kamen mir mehrmals so zu Ohren. Auch deshalb blieb
mir vieles davon wörtlich hängen.
Eine deutsche
Geheimpolizei, die ursprünglich mit alten Nazis zusammenarbeitete. Sie
ausgerechnet „Verfassungsschutz“ zu nennen, dürfte selbst George Orwell
kaum in den Sinn gekommen sein. Ein
„Verfassungsschutz“, der in den letzten Jahrzehnten auch mit Leuten aus
der Neo-Nazi-Szene angebandelt haben soll. Stichwort NSU.
Wenn der
„Verfassungsschutz“ jetzt, 2021, ausgerechnet diejenigen „beobachten“
soll, die erklären, gerade öffentlich für die Verfassung, das
Grundgesetz, einzutreten, dann zwingt das förmlich zu Fragen.
Oder – ganz
offen – zur Zustimmung? Wenn ja, dann mit Zuversicht und dem bewährten
Motto „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Immerhin.